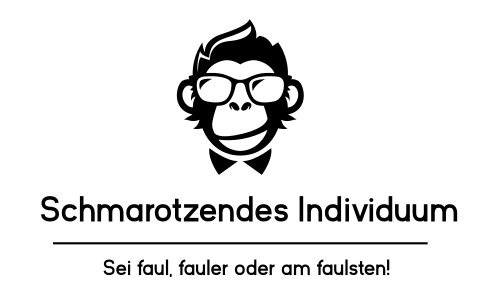Es gibt zwei Arten, sich krankzumelden. Die erste beginnt mit Fieber, Schweiß, Virus.
Die zweite mit: „Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich geh jetzt einfach nicht mehr.“
(Oder wie die moderne Diagnose lautet: Meeting Allergie mit Outlook Intoleranz.)
Und während die Gesellschaft brav Hustensaft schlürft und auf Genesung hofft, gibt es eine kleine, tapfere Minderheit, die mit vollem Bewusstsein krankfeiert. Nicht weil sie lügt, sondern weil sie endlich ehrlich ist: Ich bin nicht körperlich krank. Ich bin systemisch überfordert. Denn machen wir uns nichts vor: In einer Welt, in der der Wecker früher klingelt als das Leben, in der Meetings wichtiger sind als Mahlzeiten und der Kaffee intravenös läuft, ist das Krankfeiern ein Akt der Selbstfürsorge, eine Wellnessbehandlung auf Krankenschein.
(Besser als jedes Yoga Retreat, günstiger als jede Therapie, und mit weniger Esoterik als ein Achtsamkeitskurs bei LinkedIn.)
Man sagt, Krankfeiern sei asozial. Aber wer bitte hält sonst unsere Wirtschaft am Laufen? Würden alle Burnout-Kandidaten plötzlich Urlaub nehmen, wer soll denn dann in der Gastronomie sitzen und Latte Macchiato posten?
(Hashtag #Selbstfürsorge, Hashtag #KrankUndStolzDrauf.)
Krankfeierer sind die wahren Helden des Binnenkonsums.
(Systemrelevanter als Politiker und sie tauchen wenigstens in der Kantine auf.)
Sie stärken mit jedem entspannten Brunch das Bruttosozialprodukt
und ermöglichen dem Café um die Ecke eine Zukunft jenseits der Insolvenz.
(Wer braucht schon Konjunkturpakete, wenn man einfach montags nicht kommt?)
Work Life Balance oder: Der Versuch, nicht komplett durchzudrehen. In einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, in der „Work Life Balance“ eigentlich heißt: „Work“ 60 %, „Life“ 40 %, und das nur, wenn du Freitag um 16 Uhr flüchtest, wird das Krankfeiern zum notwendigen Gegengewicht. Ein „Ich bin raus“ mit Attest. Ein „Ich existiere auch außerhalb von Excel“ mit offizieller Stempelmarke.
(Manche sagen „Krank“, andere sagen: „Ich habe mich selbst aktualisiert.“)
Und Hand aufs Herz: Wer sich noch nie aus mentaler Notwendigkeit krankgemeldet hat, hat entweder kein Nervensystem, oder ist Teil des Problems.
(Oder hat einfach einen sehr guten Psychiater auf Kurzwahl.)
Denn das Krankfeiern ist nicht nur Selbstschutz. Es ist auch Sozialverhalten:
Du schützt deine Kolleg*innen vor deiner passiv aggressiven Aura. Du weißt schon, diese besondere Atmosphäre, in der jeder Tastendruck wie ein Vorwurf klingt, jeder Blick ein unausgesprochenes „Wie kann man nur so ineffizient sein?“ impliziert und das Geräusch deiner Kaffeetasse auf dem Tisch plötzlich eine emotionale Drohung ist.
(Subtext: „Wenn ich noch eine E-Mail mit dem Betreff ‘kurze Frage’ bekomme, brenne ich dieses Gebäude nieder, aber in Ruhe, mit Stil.“)
Deine Aura an solchen Tagen ist nicht einfach schlechte Laune. Nein. Sie ist eine energetische Kriegserklärung verpackt in höfliche Mails mit dem Betreff: „Nur kurz eine Rückfrage.“ Dein Gang durch den Flur fühlt sich an wie das letzte Drittel eines Tarantino Films. Jeder spürt: Du bist da. Und du solltest es eigentlich nicht sein. Dein Monitor leuchtet, aber dein Geist liegt in der Hängematte. Du redest wenig, aber deine Stille brüllt: „Ich hasse alles, aber professionell.“
(Corporate Depression: Jetzt auch in PowerPoint verfügbar!)
Und ganz ehrlich: Bevor du zum dritten Mal heute „LG“ schreibst, obwohl du innerlich „Verreckt doch alle“ meinst, melde dich lieber krank. Für dich. Für die anderen. Für den sozialen Frieden im Großraumbüro. Mein Fazit ist Krankfeiern ist keine Schwäche. Es ist ein stiller Aufstand. Ein leiser Mittelfinger im Namen der Lebensfreude. Ein Kaffee um 11 Uhr, der sagt: „Nicht heute, Kapitalismus. Nicht heute.“
(Und wenn jemand fragt: „Geht’s dir besser?“ einfach sagen: „Ja, weil ich euch nicht sehen musste.“)